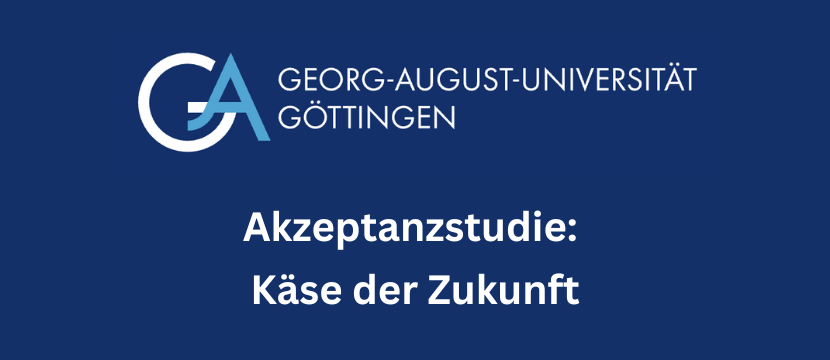Warum Zusammenarbeit der Schlüssel zur Innovation ist
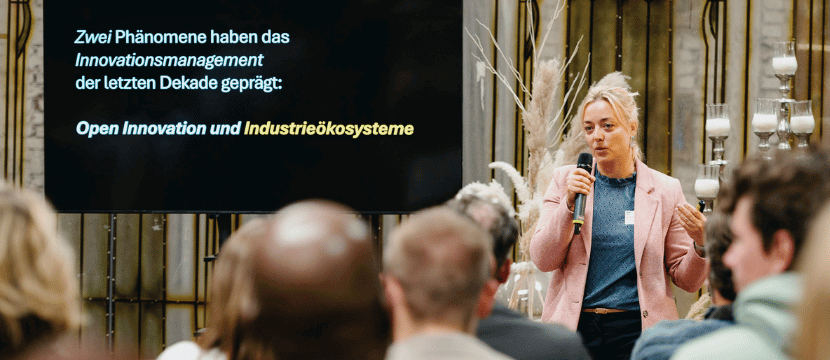
Von der Barbie-Puppe zum Plattform-Geschäftsmodell – Dr. Kathleen Diener erklärt, wie erfolgreiche Innovation heute funktioniert
Auf der Ideenfutter Expo hielt Prof. Dr. Kathleen Diener, Vizepräsidentin Forschung & Innovation der Hochschule Niederrhein Keynote, die aufzeigte, warum die Zukunft der Innovation nicht in geschlossenen Unternehmensmauern liegt, sondern in offenen Ökosystemen und strategischen Partnerschaften. Ihre zentrale Botschaft: Wer heute erfolgreich innovieren will, muss lernen, externe Wissensquellen zu nutzen und komplementäre Partnerschaften aufzubauen.
Das Innovationspotenzial liegt draußen
Kathleen startete mit einem überraschenden Beispiel: Die Barbie-Puppe – eine der erfolgreichsten Spielzeuginnovationen aller Zeiten – wurde nicht von Spielzeugexperten entwickelt, sondern von einer frustrierten Nutzerin. Ruth Handler, die Frau des Mattel-CEOs, beobachtete, dass ihre Tochter gerne mit Puppen das Erwachsenenleben imitierte, aber kein passendes Spielzeug dafür hatte. Die männlichen Experten im Unternehmen winkten ab: "Wir wissen, wie der Markt funktioniert." Doch Handler entdeckte im Urlaub die deutsche Bildpuppe Lilli, brachte sie mit – und ein Jahr später war die Barbie auf dem Markt.
Diese Geschichte illustriert ein fundamentales Prinzip: beinahe 80% der Innovationsprobleme, die Unternehmen haben, sind in anderen Wissensdomänen bereits gelöst. Das gilt vom Mountainbike (entwickelt von frustrierten Radfahrern) bis zum Jogging-Buggy (von Eltern erfunden) – die meisten Sport-Innovationen stammen von Nutzenden, nicht von der Industrie.
Das Not-Invented-Here-Syndrom überwinden
Die größte Hürde für Open Innovation ist eine psychologische: das Not-Invented-Here-Syndrom – eine ablehnende Einstellung gegenüber Wissen, das von außen kommt. Kathleen identifizierte typische Barrieren:
- Konservatives Management, das glaubt, alle Probleme und Lösungen bereits zu kennen
- Angst, dass Offenheit etablierte Strukturen bedroht
- Schwierigkeiten, interne Probleme überhaupt nach außen zu kommunizieren
Was bei Open Innovation NICHT funktioniert
Aus Praxisprojekten hat Kathleens Forschungs:kolleginnen klare Anti-Patterns identifiziert:
- Kapazitätseinsparung als Motiv: "Wir kooperieren mit vielen draußen, dann brauchen wir weniger Personal" – das führt zu null interner Unterstützung
- Budget auf zu viele Aktivitäten verteilen: Viel testen, aber nichts kommt am Ende raus
- Akteure nur "nebenbei" damit beauftragen: Funktioniert nicht, wenn Innovation nicht zur Hauptaufgabe wird
- Keine Timeline und kein klares Ziel: Produziert nur Sunk Costs
Die Erfolgsfaktoren für Open Innovation
Stattdessen braucht es:
- Eine offene Innovationskultur mit klarem Rollenverständnis
- Promotoren – Akteure mit Expertise, Macht (Ressourcen verteilen) und der Fähigkeit, Lobbyarbeit zu machen
- Ownership: Es muss jemandes "Baby" sein– genau wie bei Start-ups
- Realistische Timeline: Keine selbst vorgegaukelten Erwartungen
Von Open Innovation zu Industrieökosystemen
Das nächste Level nach Open Innovation sind Industrieökosysteme – wo es nicht nur um Wissenstransfer geht, sondern um gemeinsame Wertschöpfung. Kathleen zeigte die Entwicklung vom Produkt zum Plattform-Geschäftsmodell am Beispiel der Landmaschinenindustrie:
- Hardware verkaufen
- Sensorik ergänzen für mehr Informationen
- Produkt-Service-Systeme (z.B. Predictive Maintenance)
- Plattform-Ökosystem: Die digitale Ebene wird geöffnet, Partner aus Wetter-Systemen, Pflanzenschutz etc. kombinieren Daten für gemeinsame Wertschöpfung
Der Kuchen wird größer, nicht nur geteilt
Ein zentraler Punkt: Bei erfolgreichen Ökosystemen geht es nicht darum, einen bestehenden Kuchen mit mehr Partnern zu teilen. Durch geschickte Kombination von Wertbeiträgen wird der Kuchen größer gebacken – jeder Partner profitiert von der erhöhten Gesamtwertschöpfung.
Neue Kernkompetenzen erforderlich
Für Plattform-Geschäftsmodelle brauchen Unternehmen neue Fähigkeiten:
- Orkestrierungsfähigkeit: Die richtigen Akteure identifizieren und verbinden
- Übersetzungskompetenz: Eine gemeinsame Sprache finden zwischen verschiedenen Wissensdomänen
- Gemeinsame Agenda setzen mit unabhängigen Akteuren
- Fair Value Distribution: Win-Win-Win für alle Partner
- In Komplementaritätseffekten denken: Produkt A + Produkt B = C muss mehr Wert ergeben als A und B einzeln
Warum jetzt? Drei Gründe für den Plattform-Boom
- Regulierungshürden umgehen: Geschickte Partnernetzwerke bringen Best Practice und Infrastruktur mit
- In reifen, zersplitterten Märkten agieren: Neue Wertschöpfung statt Preiskampf
- Wissen-Assets mit Partnern integrieren: Spart Übersetzungsleistung
Legacy kann ein Vorteil sein
Überraschende Erkenntnis: Unternehmenserbe – alle Assets, Netzwerkkontakte, etablierte Strukturen – verhindert Transformation nicht, sondern kann ein strategischer Vorteil sein. Entscheidend ist: Einen klaren Fokus setzen. Nicht alles parallel machen, sondern gezielt ansetzen: Digitalisiere ich mein Produkt? Baue ich mein Netzwerk aus? Wo liegt mein Innovationsschwerpunkt?
Der Appell: Nutzt Innovationsräume
Kathleen schloss mit einem Aufruf, die vorhandenen Innovationsräume zu nutzen – vom Brightlands Campus über Bioökonomie-Cluster bis zum Launch Center Lebensmittel. Diese Räume bieten geschützte Umgebungen, um früh zu scheitern, schnell zu lernen, zu testen und komplementäre Partner zu finden.
Die Kernbotschaft: Innovation entsteht heute nicht mehr in isolierten F&E-Abteilungen, sondern in offenen, orchestrierten Ökosystemen. Wer das Potenzial außerhalb der eigenen Unternehmensgrenzen nutzt, komplementäre Partnerschaften eingeht und in gemeinsamer Wertschöpfung denkt, hat die besten Chancen, die Zukunft mitzugestalten.
Kommentare

Wir vernetzen Akteure der Agrar- und Lebensmittelbranche vom Feld zum Regal, um gemeinsam zukunftsgerichtete Lösungen für die Branchen zu entwickeln.
Übersicht
Mitgliedschaft
© 2026 Foodhub NRW e.V.